
Wenn Behindertenfeindlichkeit mir die Lust aufs Lesen verdirbt
Wie schreibe ich eine Rezension für ein Buch, das mich wirklich gut unterhalten hat und dessen Figuren ich liebte. Das mich aber gleichzeitig durch behindertenfeindliche, ableistische Perspektiven immer wieder enttäuscht und schlicht geärgert hat?
Ich war kurz davor die Antwort „gar nicht“ lauten zu lassen. Weil ich keine Lust mehr darauf habe und solchen Titeln eigentlich keine Aufmerksamkeit schenken möchte. Aber vielleicht sollten wir da mal drüber sprechen?
Ich will doch eigentlich auch nur in Ruhe lesen und mich an spannenden Charakteren und interessanten Entwicklungen freuen. Aber das kann ich nicht so ungehindert. Weil es mich nicht entspannt, wenn behinderte, psychisch oder chronisch kranke Menschen in einer Geschichte immer wieder herabgewürdigt werden.
Ich brauche ja nicht mal ständig perfekte Repräsentation. Aber wie wär’s, wenn Menschen wie ich nicht nur als Witzfiguren und abschreckende Beispiele (vor allem im Beziehungskontext) vorkommen würden?!
Fehler sind normal
Natürlich gibt es Fehltritte, die aus Unwissenheit entstehen. Über diese kleineren problematischen Dinge muss ich oft hinwegsehen. Ableismus ist einfach viel zu weit verbreitet und auch über sexistisches oder rassistisches, über queer- oder transfeindliches stolpert man in zu vielen Medien. Wir alle wachsen in einem System auf, in dem bestimmte Diskriminierungen zur Sozialisierung gehören. Es ist super schwer sich das bewusst zu machen und aktiv dagegen zu arbeiten. Logisch, dass da auch Fehler passieren.
Schon als Kind musste ich damit umgehen, dass Mädchen wie ich nicht die Disney-Prinzessinnen waren, sondern sich doch vielleicht eher mit dem Glöckner identifizieren sollten. Könnt ihr euch das vorstellen?!
Aber weil ich mich sonst gar nicht mehr an Literatur und Filmen freuen könnte, musste und muss ich das hinnehmen. Bis zu einem gewissen Grad kann ich sowas auch ausblenden. Das heißt ich nehme diese Problematiken zwar wahr, lese aber darüber hinweg. Wenn jedoch in einem Roman immer wieder sowohl sprachlich, als auch durch die verwendeten Bilder gezeigt wird, dass behinderte Menschen weniger wert sind, vergeht mir die Freude an der Lektüre. Dann sagen die Autor*innen zu mir: „Du gehörst nicht dazu!“ Und warum soll ich dann ihre Bücher lesen und empfehlen?
Zu viel ist zu viel
In „Meine Mutter, unser wildes Leben und alles dazwischen“ ist das leider so passiert. Da wird „behindert“ mehrfach als Schimpfwort verwendet und behinderte Menschen kommen immer genau dann zur Sprache, wenn Beispiele für absurde Beziehungskandidaten gebraucht werden. Wer könnte schon einen Mann mit „Buckel“ lieben? Völlig abweg… Moment? Vielleicht gar nicht so abwegig, sondern nur ein Anzeichen für die Denkweise der Autorin? Es hat mich einfach ermüdet.
Und psychische Krankheiten hätten durchaus ein zentrales Thema im Roman spielen können! Beziehungsweise tun sie das in Ansätzen sogar. Der Roman handelt von einer ungewöhnlichen Mutter-Tochter-Beziehung. Da geht es viel um Erwartungen und soziale Normen, welche die Mutter immer wieder sprengt. Sie ist jedoch nicht nur extrovertiert und extravagant, sondern auch Suchtkrank. Der Alkohol wird ihr immer wieder zum Verhängnis und auch ihr jahrelanger Kampf gegen Depressionen wird im Roman mehrfach behandelt.
Ich hätte mir gewünscht, dass die Autorin es besser schafft mit ihren farbenfrohen und wirklich witzigen Charakteren eine Geschichte zu erzählen, die für alle Menschen inklusiv ein Vergnügen ist. Denn genau das würde zur Botschaft der Geschichte passen: dass wir auf Normen nicht viel geben sollen und das eigentliche Glück darin liegt unseren eigenen Weg zu entdecken und zu erobern.
„Meine Mutter, unser wildes Leben und alles dazwischen“ von Joanna Nadin, übersetzt von Astrid Finke, erschienen im Limes Verlag, 448 Seiten. Werbung: Wenn du mich unterstützen möchtest, kannst du das Buch (oder beliebige andere) über meine Partner genialokal, Hugendubel, Bücher.de kaufen.




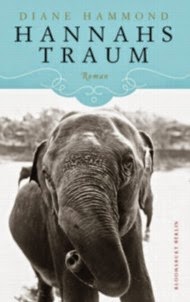
+ There are no comments
Add yours